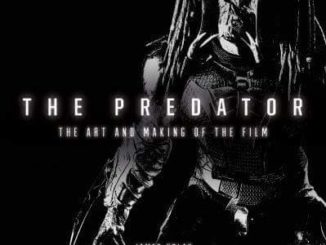Zum 35. Geburtstag des bahnbrechenden ersten Teils, wird mit „Prey“ das nunmehr fünfte Kapitel der Predator-Saga und der siebte Film des gesamten Franchises veröffentlicht. Ein Werk, welches sich vom gesamten inhaltlichen Ballast der Serie befreit, indem es die Geschichte isoliert dreihundert Jahre in der Vergangenheit ansiedelt …
Offizielle Synopsis: „Prey“ spielt vor 300 Jahren im Volk der Comanchen und erzählt die Geschichte einer jungen Frau, Naru, einer wilden und talentierten Kriegerin. Sie wuchs im Schatten einiger der legendärsten Jäger der Great Plains auf. Als ihr Lager bedroht wird, macht sie sich auf den Weg, um ihr Volk zu schützen. Die Bedrohung, mit der Naru konfrontiert wird, entpuppt sich als ein hochentwickeltes außerirdisches Raubtier mit einem technischen Arsenal neuen Ausmaßes, was zu einem bösartigen und erschreckenden Showdown zwischen Naru und dem unbekannten Wesen führt.
Was heutzutage Normalität ist, stellte Mitte der 1980er-Jahre noch eine Kuriosität dar: endlos erscheinende Filmreihen, die sich nicht nur von Fortsetzung zu Fortsetzung hangeln, sondern mit Prequels und Spin-Offs ihre Welten drastisch erweitern. Wie absurd diese Idee in den frühen 1980er-Jahren erscheinen musste, zeigte vielleicht der Spoof-Film „Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug“ („Airplane!“, 1980) auf, der sich in einer Szene über die Rocky-Saga lustig machte – wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt als es „nur“ zwei Filme gab! –, in dem ein Fake-Kinoplakat von einem Opa mit Boxhandschuhen und dem Titel „Rocky XXXVIII“ als Hintergrund-Gag präsentiert wurde. Auch wenn bis zum heutigen Tage keine 27 Fortsetzungen von „Rocky“ (1976) produziert wurden, hat man mit insgesamt neun Filmen zumindest eine Jahrzehnte umspannende Saga abgeliefert, die mit dem vierten Teil, „Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts“ („Rocky IV“, 1985), einen gewissen absurden Höhepunkt erreichte. So absurd, dass zwei junge Drehbuchautoren meinten, dass Rocky nun nur noch gegen einen außerirdischen Boxer kämpfen könnte, um für eine weitere Fortsetzung noch innovativ zu sein. Es wurde dann im fünften Teil der Hinterhofschläger Tommy „The Machine“ Gunn, doch den Kampf Mensch gegen Alien, setzten die Autoren in einem eigenen Skript um, welches letztlich zum Kultklassiker „Predator“ (1987) werden sollte.
Ursprünglich unter dem Titel „Hunter“ verfasst, shoppten die beiden Brüder Jim und John Thomas ihr Drehbuch auf gut Glück durch ganz Hollywood, bis es auf dem Tisch des Produzenten Joel Silver landete. Dieser erkannte das Potenzial der einfach gestrickten Geschichte und hatte auch sogleich einen Protagonisten im Kopf: Arnold Schwarzenegger, mit dem er vorab den amüsanten Actioner „Phantom Kommando“ („Commando“, 1985) produzierte. Die steirische Eiche konnte mit Werken wie „Conan der Barbar“ („Conan the Barbarian“, 1982) oder „Terminator“ („The Terminator“, 1984) bereits internationale Erfolge vorweisen, doch waren dies zumeist kleinere Genre-Produktionen von Independent-Studios. Hinter „Hunter“ stand allerdings nicht nur Joel Silver, sondern auch 20th Century Fox. Schwarzenegger erkannte den Wert der Geschichte schnell, doch verstand auch, dass er als muskelbepackter Actionheld den Film nicht alleine verkaufen könnte. Er forderte Rewrites an, die die Handlung und den Cast massiv erweitern sollten. John McTiernan wurde als Regisseur angeheuert und die anfangs holprige Produktion – so spielte ursprünglich tatsächlich Jean-Claude Van Dame den Predator als heuschreckenartiges Wesen – entwickelte sich zu einem Klassiker des 80er-Jahre-Actionkinos. Ein wilder Genre-Mix, der das populäre Söldnerkino seiner Zeit mit Science-Fiction-Horror verband. Roh, brutal, temporeich, und gefüllt mit Onelinern, die noch heute zitiert werden („If it bleeds, we can kill it.“).

(© 20th Century Studios. All Rights Reserved.)
Der massive Erfolg an den internationalen Kinokassen – weltweit spielte „Predator“ rund 98 Millionen US-Dollar ein (inflationsbereinigt 2022: rund 262 Millionen US-Dollar) – führte natürlich zu dem Wunsch seitens des Studios, ein Sequel zu inszenieren. Schwarzenegger war nicht abgeneigt, doch seine Karriere und somit sein Marktwert entwickelte sich mit Werken wie „Die totale Erinnerung“ („Totel Recall“, 1990) und „Terminator 2 – Tag der Abrechnung“ („Terminator 2: Judgement Day“, 1991) steil nach oben und laut Produzent John Davis war Schwarzenegger für das geplante Sequel schlicht zu teuer („The deal broke down over $250,000, which is a shame.“). Vielleicht war dies letztlich auch ganz gut, denn es zwang die Produktion dazu, nicht nur einfach ein vollkommen neues Setting für die Fortsetzung zu etablieren, sondern auch neue Charaktere einzuführen. Die Ereignisse in „Predator“ wurden referenziert, die Geschichte sollte aber neu sein, auch wenn sie starke Ähnlichkeit zum Original aufwies. Heraus kam „Predator 2“ (1990), der die Handlung vom kolumbianischen Dschungel in die Großstadt Los Angeles verlegte. Wohlgemerkt aus damaliger Sicht ein „futuristischer“ Moloch. Der zweite Teil spielte einige Jahre in der Zukunft, in der sich die „Stadt der Engel“ in ein Höllenloch verwandelt hat.

(© 20th Century Studios. All Rights Reserved.)
„Predator 2“ ist als erste Fortführung der Reihe ein Paradebeispiel dafür, wie ein Sequel die Welt und Mythologie des Vorgängers erweitern und gleichzeitig respektieren kann, ohne diese aber zu verändern oder redundant wirken zu lassen. Vielleicht eine der besten Fortsetzungen des Genres und für das gesamte heutige Franchise von unglaublicher Bedeutung. Am Ende des zweiten Teils wurde (eigentlich als Insider-Gag) über eine Requisite im Hintergrund etabliert, dass die Aliens aus „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ („Alien“, 1979) in demselben Film-Universum existieren wie die Predators. Beide besitzen gar eine gemeinsame Vergangenheit. Diese Idee basierte auf einem Comic-Crossover von Dark Horse aus dem Jahre 1989 und wurde nicht, wie oft behauptet, durch „Predator 2“ etabliert, aufgrund der Tatsache, dass beide Franchises allerdings zu 20th Century Fox gehörten, konnte man dieses Konzept auch für die Leinwand ausbauen. Es folgten sieben Filme über drei Jahrzehnte.

(© 20th Century Studios. All Rights Reserved.)
Jim und John Thomas‘ Idee zu einem ursprünglich recht simplen Sci-Fi-Actioner, die letztlich der Sequel-Wut der Rocky-Saga entsprang, hatte sich über die Jahrzehnte zu einem multimedialen Franchise entwickelt. Neben den Filmen wurden auch fleißig Romane, Comics und Videospiele produziert. Alle Werke standen allerdings stets vor demselben Problem: Wie will man die Geschichte sinnvoll weitererzählen, wenn die Fan-Gemeinde letztlich ein und denselben Plot nur erneut erleben will (ein Problem, vor dem zahlreiche Franchises stehen; man denke hierbei insbesondere an die „Jurassic Park/World“-Reihe). Und so überrascht es auch nicht, dass fast alle Predator-Filme letztlich Varianten derselben Idee sind: Ein außerirdischer Jäger jagt Menschen. Im bereits erwähnten zweiten Teil änderte man das Setting und verlegte die Handlung in den Großstadt-Dschungel. Für „Predators“ (2010) transportierte man Menschen auf einen der Heimatplaneten der Predatoren und für „The Predator“ (2018) erweiterte man die Mythologie drastisch, indem man nicht nur etablierte, dass die Predatoren sich mittels menschlicher DNA weiterentwickeln wollen, sondern am Ende die Menschen sogar in einem Bürgerkrieg verschiedener Predator-Clans hineingezogen werden und sie mit ihrer Technologie ausgestattet werden.

(© 20th Century Studios. All Rights Reserved.)
Die beiden Spin-Off-Filme „Alien vs. Predator“ (2004) und „Aliens vs. Predator 2“ („Aliens vs. Predator: Requiem“, 2007) ließen die Menschen hingegen zwischen die Fronten beider außerirdischer Spezies geraten. Zuerst in der Arktis und dann in einer US-Kleinstadt. Es gibt wohl kaum noch Settings oder Twists, die man auf die ein oder andere Art und Weise nicht verwendet hätte, weitere Kapitel erscheinen aufgrund der Popularität dennoch unvermeidlich. Und so präsentiert uns nun 20th Century Studios (das „Fox“ wurde nach der Disney-Übernahme gestrichen) den mittlerweile siebten Film der Reihe – rein von der Masse her, hat man das Rocky-Franchise übrigens bald eingeholt –, der sich in die Vergangenheit begibt, um Altbekanntes als Neues präsentieren zu wollen.

(© 20th Century Studios. All Rights Reserved.)
Ursprünglich unter dem Titel „Skulls“ in Produktion gegangen, sollte „Prey“ eine Art von Geheimprojekt werden, welches seine Verbindung zum Predator-Franchise erst spät offenbarte. Das berühmt-berüchtigte Internet konnte diesen Twist allerdings nicht lange geheim gehalten, und noch vor Drehbeginn berichteten zahlreiche Webseiten über die wirkliche Natur der Handlung. Dies ist schade, ein möglicher Überraschungseffekt ist somit dahin, letztlich hätte dieser aber kaum inhaltliche Auswirkungen gehabt. Dass es sich bei „Prey“ um den fünften Teil und siebten Film des Franchises handelt, offenbart das Werk überraschend frühzeitig. Sicherlich auch, weil Regisseur Trachtenberg, der vorab Filme wie „10 Cloverfield Lane“ (2016) inszenierte, sich vollends darüber bewusst ist, dass er mit der zögerlichen Offenbarung des außerirdischen Jägers kaum noch überraschen kann. Nach 35 Jahren kennt das Zielpublikum den unsichtbaren Weidmann aus dem All genau. Seine sukzessive Enthüllung enthält keinen nennenswerten Spannungsbogen mehr und so konzentriert sich das Werk anfangs auch vollends auf die junge Comanchen-Kriegerin Naru (Amber Midthunder). Ihr Leben und die Kultur ihres indigenen Stammes stehen im Vordergrund der Geschichte. Erst zögerlich wird der Predator Teil der Handlung, dessen Einführung als Teil eines historischen „Clash of Cultures“ präsentiert wird.
Denn die Comanche-Nation wird nicht nur von dem außerirdischen Jäger bedroht, sondern auch vom unaufhaltsamen Vorrücken der europäischen Siedler (hier: französische Waldläufer), die nicht nur das Land okkupieren und die indigenen Völker verdrängen, sondern auch die Natur unterwerfen wollen. Ein oft verdrängtes Stück nordamerikanischer Geschichte. Nicht nur ganze Kulturvölker standen vor der Ausrottung, sondern auch die Tierwelt. Es grenzt an ein Wunder, dass heutzutage noch Büffel existieren. Der Film spielt mit diesen historischen Entwicklungen; hat sich deswegen wohl auch bereits zur Zielscheibe populistischer YouTuber gemacht, die dem Werk in einer reflexartigen Hysterie eine Woke-Ideologie unterstellen wollen. „Prey“ ist aber smart genug, um dies inhaltlich nicht zu forcieren. Hauptcharakter Naru ist weder stärker noch schwächer als ihre männlichen Gegenstücke. Die Art und Weise, wie sie den Predator besiegen will, erinnert gar an das Finale des Originalfilms, indem Schwarzenegger durch Fallen den Predator zur Strecke bringt und eben nicht auf Technologie oder brachiale Feuerkraft setzt. Diesem Konzept unterwirft sich „Prey“ vollends, auch wenn sich der Film einige Schlupflöcher suchen muss, um den Kampf zwischen hochtechnologisierten Alien und primitiver Kriegerin überzeugend umsetzen zu können. Die Natur und Tierwelt Nordamerikas helfen beim Gefecht genauso wie die Werkzeuge der vorrückenden europäischen Zivilisationen.
„Prey“ stellt die historische Realität in wenigen Bildern teils effektiver dar, als so manches großes Hollywood-Epos, auch wenn das Werk sich natürlich gewisse Freiheiten nimmt. Die Annahme, dass die nord-amerikanischen Völker eins mit der Natur waren und als ehrenvolle Krieger gegeneinander kämpften, gilt mittlerweile als überholt. Zwar eckt „Prey“ diesbezüglich nicht an und gibt sich auch gewissen positiven Klischees hin, schaut aber wiederum auf die durchweg patriarchalischen Gesellschaften der „Indianer“-Stämme weitaus ehrlicher. Vielleicht auch, weil es als Genre-Produktion sich erlauben kann, gewisse Grenzen zu überschreiten. Auch inszenatorisch.

(© 20th Century Studios. All Rights Reserved.)
Große Teile des Werks sind auf Französisch und Comanche gehalten. Zumindest für den US-Markt soll sogar eine (synchronisierte) Sprachfassung erscheinen, die gänzlich auf Englisch verzichtet. Dieser Twist, wenn man es so bezeichnen will, hilft dem Werk tatsächlich dabei an Authentizität und somit im Kontext der Filmreihe an Originalität zu gewinnen. Denn so sehr sich der Verlauf der Storyline mit dem Originalfilm ähnelt (oder ähneln muss, um dem Kanon des Franchises treu zu bleiben), so sehr distanziert es sich inszenatorisch von ihm. „Prey“ ist ein Survival-Film im wahrsten Sinne des Wortes, indem sich eine junge Kriegerin nicht nur gegen irdische, sondern auch außerirdische Bedrohungen behaupten muss. Der Weg zum Triumph ist natürlich von gewissen genre-typischen Tropes geprägt, die den älteren Fans bekannt sind, aber die 35 Jahre alte Filmreihe vielleicht für eine neue Generation öffnen kann. Sollte dies gelingen, so hätte „Prey“ für das Predator-Franchise vielleicht mehr getan als die letzten vier Filme zusammen. So interessant dieses ungewöhnliche Setting auch ist, so irritierend sind dennoch leider einige Effekteinstellungen. Die Tierwelt Nordamerikas stammt größtenteils aus dem Rechner, was aufgrund des moderaten Budgets nicht immer vollends überzeugen kann. Es wäre durchaus interessant gewesen, einen noch raueren Ansatz zu wählen und sich vielleicht inszenatorisch an Werken wie „Ayla und der Clan des Bären“ („The Clan of the Cave Bear“, 1981), „Pathfinder“ („Ofelaš“, 1987) oder gar „Am Anfang war das Feuer“ („La Guerre du feu“, 1981) zu orientieren – vielleicht sogar an „The Revenant – Der Rückkehrer“ („The Revenant“, 2015) –, denn die Härte dieser Filme erreicht „Prey“ bedauerlicherweise nie.

(© 20th Century Studios. All Rights Reserved.)
„Prey“ geht inhaltlich sicherlich den Weg des geringsten Widerstandes. Der mittlerweile siebte Film innerhalb der gesamten Reihe versucht nicht, das Franchise neu zu erfinden oder im Gegensatz zu seinen Vorgängern die Mythologie drastisch zu erweitern. Die bekannte Handlung und der zu erwartende Verlauf der Storyline wird lediglich auf ein neues Setting übertragen, welches man allerdings kreativ, packend und ohne Längen präsentiert. Eine Rückkehr zu den Wurzeln. Vielleicht genau der richtige Impuls, den das Franchise nach dem polarisierenden vierten Teil benötigt hat.
‐ Markus Haage
| Werbung |